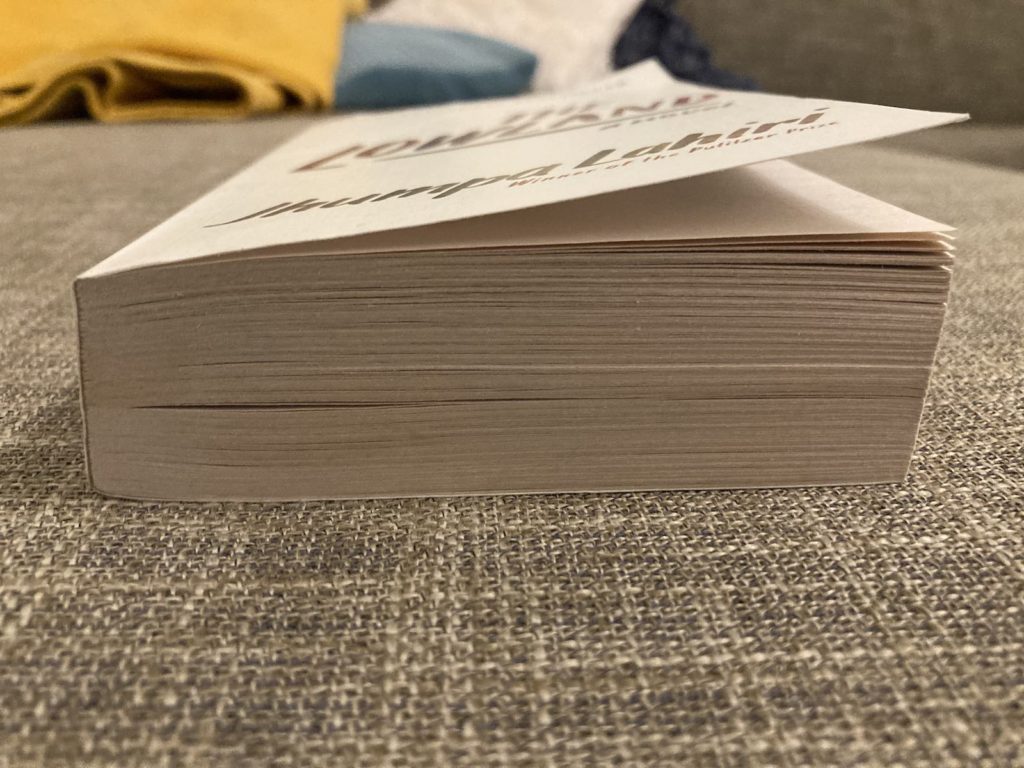Eine der Segnungen dieser Osterferien war für mich, mal wieder Zeit dafür zu haben, ein „richtig gutes Buch zu lesen“ – kein pragmatisches-belehrendes Sachbuch, sondern ein langer Roman, der einen mitreißt und die nüchterne Realität vergessen lässt. Eine Sache, die mich beim Lesen immer wieder fasziniert, ist das Zusammenspiel von Aktion und Reaktion, von Gespräch und Reflexion. Kein Film kann so so eindringlich und so andauernd Einblicke in die Gedankenwelt eines Charakters geben wie gute Romane.
Während ich in den letzten Tagen auf diese Weise in das relativ deprimierende Leben und Fühlen einer in den USA lebenden problembeladenen indischen Familie (The Lowland) hineingenommen wurde, wurde trotz der einnehmenden Story mein pragmatisch-belehrender Geist geweckt. Nachdem ich in die Gedankenwelten der Charaktere eingetaucht bin und nach und nach verstanden habe, wie sie ticken, was ihre Probleme sind und wie sie über die anderen Mitmenschen denken und nachdem ich zunehmend von der Dysfunktionalität der Familie frustriert war, konnte ich nicht anders, als den Charakteren laut zuzurufen: „HALLO! REDET MITEINANDER! TEILT EUCH MIT!“ Ein Großteil der Schwierigkeiten, die dieses Buch antreiben, hätten vermieden werden können, wenn die Menschen sich einfach offen ausgetauscht hätten. Stattdessen verschweigt ein Ehepaar einen schrecklichen Vorfall über Jahre; die Schwiegertochter wird einfach weitestgehend ignoriert; ein zurückhaltender Mann schafft es bis ins hohe Alter nicht, unbequeme Dinge anzusprechen. All dieses und viel mehr führt in dem Roman zu einer Eskalation von Unzufriedenheit, Stillstand und Zerrissenheit.
Nun mag ein Teil der Verschwiegenheit im Roman kulturell bedingt sein, vielleicht wird in traditionelleren Kulturen aus Scham oder Vorsicht nicht alles offen angesprochen. Womöglich tendieren Romane als Medium auch dazu, eher introvertierte Personen als Protagonisten zu haben, denn in der Spannung zwischen einer tiefsinnigen Gedankenwelt und eher wenigen Gesprächen liegt häufig ein besonderer literarischer Reiz. Überaus redselige und klar-kommunizierende Hauptcharaktere sind mir in Büchern selten begegnet.
Aber dennoch bin ich überzeugt, dass offene Kommunikation so manches Drama in dem Roman und generell im Leben präventiv verhindert hätte. So heimelig und tiefsinnig es sich manchmal in der ganz eigenen Welt von Gedanken und Emotionen anfühlt, so wenig hilfreich ist es für die Außenwelt, wenn wir uns darin verlieren und es nicht für nötig halten, einen Teil von uns zu offenbaren. Wie soll jemand anders andocken, wie soll er uns verstehen, wie wollen wir uns aufeinander zubewegen, wenn wir uns verschließen?
Doch der Offenbarung der eigenen Gedanken sind natürlich Grenzen gesetzt. Als ich Luise beim Frühstück von meiner Frustration mit der mangelnden Transparenz der Charaktere erzählte, fragte sie mich, ob ich ihr denn alle meine Gedanken mitteile. Das scheint mir nicht möglich – zu flüchtig, konfus-komplex und leider oft zu negativ ist das, was sich in meinem Kopf abspielt. Ein gewisses Maß an Feingefühl für das Gegenüber und das, was er oder sie gerade aufnehmen kann und ein Gespür für das Timing der Situation und für die Ergiebigkeit des Gedankens ist durchaus angebracht. Wenn wir beständig ein Gedankenprotokoll verteilen würden, würden wir unsere Lieben wohl oft eher verärgern und verstören. Wenn ich die westliche, digitale und teils auch therapeutische Obsession mit einer Form von Authentizität, in der man seine banalen, komplizierten und teils auch intimsten Gedanken preisgibt, beobachte, dann empfinde ich sogar einen gewissen Respekt für die würdevolle Dezenz, mit der gerade in eher traditionellen Kulturen (ich generalisiere) manche Themen gar nicht oder eher indirekt und mit vorgehaltener Hand ans Tageslicht kommen. Wenn diese Zurückhaltung jedoch Beziehungen (zer)stört und Menschen unverstanden und isoliert zurücklässt, dann ist sie eher schädlich.
Es muss also einen gewissen Mittelweg geben zwischen Kommunikationsvermeidung (oder -verweigerung) und Seelenstriptease. Je nach Persönlichkeit, Reife und eigenem Wertekanon wird dieser Mittelweg bei jedem anders aussehen. Ein guter Test, ob man kommunikativ auf dem richtigen Weg ist, scheint mir ein Gedankenexperiment zu sein, was ans eingangs erwähnte Buchlesen anknüpft: Wie würde wohl ein fähiger Autor mich als Romanfigur darstellen? Nehmen wir an, er kennt mich perfekt und möchte meinen Charakter im Roman treffend und akzentuiert beschreiben.
- Würden die Gedanken in einem passenden Verhältnis zum Reden und Handeln stehen, sodass ein rundes, nachvollziehbares Bild beim Leser entsteht?
- Würde die Kluft zwischen dem, was ich insgeheim denke, liebe, hoffe, befürchte und dem wenigen, was ich tatsächlich äußere, beim Leser Frustration oder gar Mitleid hervorrufen, weil ich einfach nicht aus dem Quark komme und anderen Charakteren mit meiner Sprachlosigkeit das Leben unnötig schwer mache?
- Würden viele meiner Aussagen gegenüber anderen angesichts meines wahren Innenlebens arg heuchlerisch, verzerrt oder unbeholfen rüberkommen?
Aber auch mit diesen Testfragen ist es schwer, „die perfekte Kongruenz“ zwischen Denken und Reden auszumachen – auch wenn einige Lebensweisheitmemes suggerieren, es wäre doch so einfach:
Die knackigen Schlussfolgerungen des Memes klingen erstmal gut und plausibel und fassen mein Anliegen in diesem Artikel gut zusammen (praktisch für diejenigen, die nicht gerne meine lange Texte lesen ;)). Aber warum leben und reden wir nicht einfach so?
Wenn ich in mich hineinhorche, merke ich, dass meine Sprachlosigkeit gerade bei schwierigen Themen oder Anliegen oft mit Scham und Faulheit zusammenhängen. Scham kommt oft da ins Spiel, wo ich lieber heile Welt spielen will und mit Lächeln und Charme alles verdecken will, was schmutzig, schwierig und schwer in mir ist. Faulheit hingegen, so trivial es klingt, führt dazu, dass ich lieber Smalltalk-Geplänkel oder Allgemeinplätze wie „Ich bin beschäftigt“, „Der Tag war okay“ oder „Corona nervt“ von mir gebe, statt die kognitive und emotionale Investition zu machen, darzulegen, was mich gerade wirklich beschäftigt, seien es eigene Sorgen, Erwartungen an andere, Enttäuschungen vom Leben oder was auch immer. Das ist auch manchmal okay, gerade wenn man zu müde und kaputt zum Reden ist; Kommunikationsverweigerung aus Bequemlichkeit sollte aber keine Gewohnheit werden.
Was kann helfen, Redescham und -trägheit zu überwinden? Neben Vorsätzen, viel Übung und guten Beispielen aus der Umgebung hilft mir besonders das Bewusstsein, dass der Autor aus dem Gedankenexperiment ja tatsächlich existieren könnte, in Form eines allwissenden und gleichzeitig liebevollen Gott. Wenn jemand meine Gedanken ohnehin schon kennt, muss ich sie vor lauter Scham und Stolz auch nicht verstecken sondern kann sie Ihm frei nennen und bekennen. Und weil ich mich vom „Autoren“ geliebt und angenommen weiß, kann ich viel mehr produktiv mit meinen Gedanken arbeiten und sie dann teilen, wenn es für Andere hilfreich, aufschlussreich und ergiebig sein könnte.